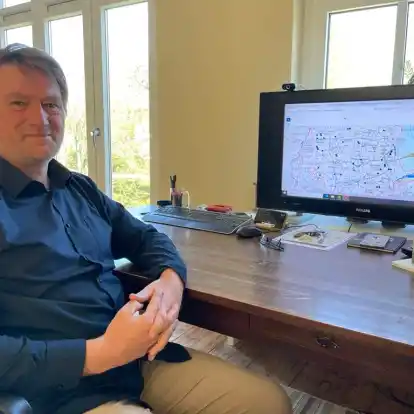Bremen - Osterholz – das sind doch diese Hochhaussiedlungen, diese Betonschluchten. . . Soweit die Vorurteile. Ja, die Hochhaussiedlungen gehören zu Osterholz – mit all ihren Problemen, Fehlentwicklungen und Neuanfängen. Zu Osterholz gehört aber auch noch eine Menge mehr. Von all dem erzählt ein Buch, das jetzt herausgekommen ist.
Der Band mit dem Titel „Osterholz nach 1945 – Ein Dorf wird zum Stadtteil“ beschäftigt sich mit der enormen Entwicklung und Veränderung der einstigen Holländersiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg. Eben noch Dorf, jetzt Hochhaussiedlung – das war schon spektakulär.
Der Autor Stefan Heesch beschreibt das auf 112 reich bebilderten Seiten. Herausgeber: Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter von Osterholz. Der Band kostet 16,90 Euro und ist in der Edition Falkenberg erschienen.
Zum „neuen“ Osterholz gehören die unterschiedlichsten Projekte. Die bundesweit beachtete Kooperation der Deutschen Kammerphilharmonie und der Gesamtschule Ost, der man etwas mehr Raum im Buch wünschen würde, zählt ebenso dazu wie zum Beispiel die „Interkulturellen Gärten“ – und nicht zuletzt Verlängerung der Straßenbahnlinie 1. Damit ist die frühere Trabantenstadt nun deutlich besser angebunden an den Rest Bremens.
Autor Heesch blickt natürlich nicht nur nach Tenever. Er hat den ganzen Stadtteil im Blick. Er schreibt über das alte Osterholz und den Nachkriegsalltag. Er schreibt über das Ellener Feld und den Osterholzer Friedhof – Bremens größter Friedhof ist das. Mit einer Kapelle aus den 20er Jahren, in deren Kuppel nach aufwendigen Renovierungsarbeiten heute wieder Sterne aus Blattgold funkeln.
Heesch schreibt über Ellenerbrok-Schevemoor und das Klinikum Bremen-Ost, über die Anfänge des großflächigen Wohnungsbaus und über die Entwicklung Blockdieks zu einem der sozialen Brennpunkte der 70er und 80er Jahre. Auch die Bandenkriege im Tenever der 80er und 90er Jahre kommen zur Sprache.
Heesch erzählt vom Quartiersmanager Joachim Barloschky, der von 1990 bis 2011 im Amt war und den Wandel des Stadtteils entscheidend mitgeprägt hat. „Er bestritt nicht, dass das Zusammenleben von Menschen aus damals 60 Nationen auf engem Raum und ohne ausreichende materielle Mittel zu großen Problemen im Leben miteinander führte. Aber er betonte auch die Chancen und Möglichkeiten, die der Ortsteil bot.“
Am Schluss seines Buchs zieht Heesch ein Fazit. Die Identität eines Stadtteils, so schreibt er, hänge ab „von der Bereitschaft der Menschen, einander zuzuhören und sich zu akzeptieren“. Wie es scheint, ist Osterholz auf dem Weg, eine neue Identität zu entwickeln – jenseits der alten Vorurteile.